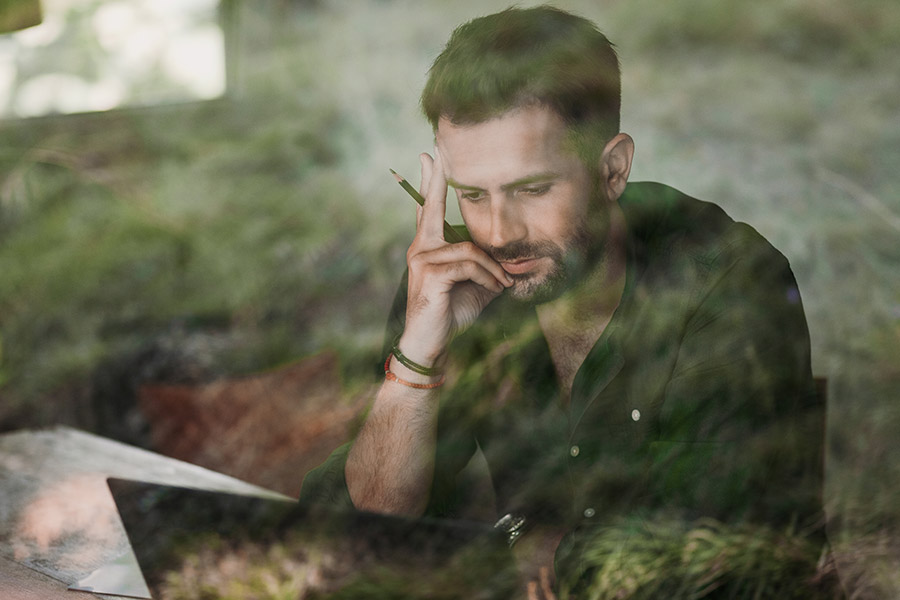Ihr Betrieb ist so einzigartig, dass es keine Lösungen „von der Stange“ gibt, sondern nur das individuelle Konzept – Gedanken zu Thema Finanzierung:
Wer ein Unternehmen führt, egal in welcher Branche, weiß, wie wichtig ausreichende finanzielle Mittel sind: Rohstoffe müssen gekauft, Arbeitskräfte bezahlt werden und hin und wieder muss eine größere Menge Geld in die Hand genommen werden für Reparaturen, Erweiterungen und Modernisierungen. Dies kann nicht immer gänzlich vom Gewinn eines Unternehmens oder Betriebs gestemmt werden, deshalb gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Finanzierung von Projekten und Anschaffungen.
Ein Landwirt braucht Rücklagen
Durch die Abhängigkeit von der Natur unterliegen die Erträge in der Landwirtschaft großen Schwankungen, daher brauchen die Betriebe größere Rücklagen als Unternehmen anderer Branchen. Dies kann auch ein Grund sein, weshalb eine Kreditanfrage erfolglos bleibt. Die letzten Jahre haben einen deutlichen Trend zu weniger, dafür größeren Höfen gezeigt, wobei gleichzeitig der Preis für Acker- und Weideland gestiegen ist. Um wettbewerbsfähig zu sein und zu bleiben, müssen landwirtschaftliche Betriebe rentabel sein.
Das Stichwort ist „Das Magische Dreieck“ aus Rentabilität (Wird ein positives Betriebsergebnis erwirtschaftet?), Stabilität (Wie krisensicher ist der Betrieb?) und Liquidität (Kann der Betrieb jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen?). So können beispielsweise kurzfristige Kredite die Zeiten zwischen Lieferung und Bezahlung durch den Kunden überbrücken und damit die Liquidität sichern. Aber auch größere Investitionen für die Zukunft, wie Modernisierungen oder die Umstellung auf eine ökologischere Bewirtschaftung müssen finanziert werden. Neue Entwicklungen, z.B. Sprühdrohnen, die Pflanzenschutzmittel gezielt verteilen können, erhöhen dabei die Ausgaben für Arbeitsgeräte, können aber gleichzeitig auch Betriebsmittel einsparen.
Als Nebenerwerb zur Landwirtschaft hat sich in den letzten Jahren die Nutzung von Solar- und Windenergieanlagen etabliert. Dadurch lässt sich der Platz auf den Dächern von Ställen und anderen Gebäuden nutzen und die Kosten für den Stromverbrauch sinken.
Zwischen Eigen- und Fremdkapital unterscheiden
Für jedes Vorhaben gibt es verschiedene, geeignete Finanzierungsarten, die auch kombiniert werden können. Grundsätzlich unterscheidet man nach der Herkunft der finanziellen Mittel und ob es sich um Eigen- oder Fremdkapitalhandelt. Bei der Eigenkapitalfinanzierung verbleiben die Finanzmittel dauerhaft im Betrieb und der/die Geldgeber erhalten ein Mitspracherecht und müssen am Gewinn beteiligt werden. Mittel aus dem Fremdkapital stehen dagegen nur befristet zur Verfügung und müssen zurückgezahlt werden.
Wird das Geld intern im Betrieb beschafft, spricht man von einer Innenfinanzierung. Im einfachsten Fall ist der Gewinn ausreichend groß, um das geplante Vorhaben selbst zu finanzieren. Dieser ist allerdings selten bzw. nur bei einem kleinen Investitionsvolumen ausreichend. Zusätzlich könnte eine Vermögensumschichtung vorgenommen werden. Dabei werden nicht benötigte Betriebsmittel zum Beispiel Maschinen, Flächen oder Immobilien verkauft oder verpachtet, wodurch liquide Mittel generiert werden. Auch Abschreibungen und Rückstellungen können einen Finanzierungseffekt haben. Letztere sind Verbindlichkeiten, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind, aber dennoch als Aufwendungen in der Bilanz verbucht werden können, zB. Steuer- oder Pensionsrückstellungen. Das dabei „zurückgestellte“ Geld steht dem Betrieb bis zur Inanspruchnahme zur Verfügung, während gleichzeitig die Steuerlast und Gewinnausschüttung vermindert werden. Abschreibungen haben den gleichen Effekt.
Außenfinanzierung und Kreditfinanzierung als mögliche Modelle
Bei einer Außenfinanzierung kommen die finanziellen Mittel von außerhalb des Betriebes. Auch hier wird zwischen Eigen- und Fremdkapital unterschieden. Bei der Beteiligungsfinanzierung investieren Gesellschafter in das Unternehmen und werden dann am Gewinn beteiligt. Erhöhen die Gesellschafter ihre Einlagen oder kommen neue dazu, steht dem Betrieb mehr Geld zur Verfügung. Allerdings steigt damit auch der Anteil der Gesellschafter am Gewinn des Unternehmens, zudem erhalten sie ein gewisses Mitspracherecht.
Die wohl bekannteste Form der Außenfinanzierung ist die Kreditfinanzierung. Dazu zählen Lieferantenkredite, bei denen die Lieferanten eine bestimmte Zahlungsfrist setzen. Wird diese nicht ausgeschöpft und die Lieferung sofort bezahlt, wird oft ein Preisnachlass – Skonto genannt- gewährt. Ebenfalls bekannt sind Kontokorrentkredite, bei denen das Bankkonto kurzzeitig überzogen wird, wobei Zinsen anfallen. Diese sind oft deutlich höher als bei einem gewöhnlichen Kredit, weshalb ein Kontokorrentkredit nur für akute und kurzfristige Engpässe bei liquiden Mitteln verwendet werden sollte. Auch Anleihen und Crowd-Finanzierung gehören zu den Kreditfinanzierungen. Besonders letzteres hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen.
Crowdfunding und -finanzierung
Durch Crowdfinanzierung oder -funding können nicht nur soziale Projekte, sondern auch Privatpersonen und Unternehmen finanziert werden. Dabei gibt es verschiedenen Formen von Spenden über Vor-Verkäufen des zu finanzierenden Produkts bis zu Krediten. Der direkte Kontakt zur Zielgruppe und potenziellen Interessenten kann bei der Entwicklung eines Projektes helfen. Bei allen Krediten ist es wichtig die Konditionen zu vergleichen, welche von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich sein können. Die wichtigsten Punkte sind dabei Zinssatz, Sicherheitsforderungen und die Tilgungsbedingungen.
Besitzt der Betrieb Forderungen gegenüber dem Handel, können diese an Dritte verkauft werden. Dies wird Factoring genannt. Die Factoring-Dienstleister können dabei auch das Forderungsmanagement übernehmen, was für weniger Büroarbeit sorgt. Der Betrieb erhält die Geldmittel vor dem eigentlichen Fälligkeitsdatum der Forderungen und kann so die Liquidität sichern. Dies ist allerdings nicht kostenlos und die Angebote der Factoring-Dienstleister hängen von der Branche und dem Risiko der Forderung ab. Eine andere Finanzierungsart, die man privat vor allem vom Autokauf kennt, ist das Leasing. Dabei wird das Objekt in Raten bezahlt und kann nach Ablauf des Vertrages für den Restbetrag gekauft werden, wodurch das Investitionsrisiko gesenkt wird. Dies bietet sich besonders bei Maschinen und neuen Technologien an und ermöglicht so ein Testen und Ausprobieren. Immer mehr Unternehmen bieten auch ein Leasing von Nutztieren wie Milchkühen, Legehennen und Schafen an.
Fördermittel von Bund und Ländern beantragen
Eine große Rolle spielen auch Fördermittel von Bund und Ländern. Für die Landwirtschaft gibt es verschiedene Subventionsprogramme zum Beispiel für Natur- und Klimaschutz. Beispiel dafür ist das Agrarinvestitionsförderungsprogramm(AFP), in dessen Rahmen Zuschüsse zur Modernisierung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit vergeben werden. Umwelt-, Klima- und Tierschutz sind dabei zentrale Kriterien, deren Verbesserung finanziert wird. Bei allen Zuschüssen ist eine frühzeitige Antragstellen wichtig, da bereits begonnene Maßnahmen oft von einer nachträglichen Förderung ausgeschlossen werden. Landwirtschaftliche Betriebe profitieren zudem von günstigen Krediten der Förderbanken, wie der bundesweiten Landwirtschaftlichen Rentenbank. Diese ermöglicht Wachstumsfinanzierungen, Liquiditätsüberbrückungen und Bürgschaften und erteilt Betriebsmittelkredite. Spezielle Angebote gibt es auch für eine Hof-Neugründung oder -übernahme, wobei ein Eigenkapitalanteil von 30 % empfohlen wird.
Durch diese breite Palette an Finanzierungsarten ergibt sich für jedes Vorhaben eine passende Möglichkeit oder eine Kombination aus verschiedenen Möglichkeiten. Dabei sind die Konsequenzen wie Zinsen, Mitspracherecht von Gesellschaftern, generelle Konditionen und Laufzeiten zu beachten. Für Letzteres gilt bei allen Finanzierungsarten die Goldene Regel: Die Länge der Tilgung sollte der Lebensdauer des Investitionsobjektes entsprechen oder „Dauer der Mittelbindung = Dauer der Mittelverfügbarkeit“. Eine professionelle Beratung kann nicht nur bei der Entscheidung der Finanzierung helfen, sondern schon im Vorfeld Chancen und Risiken des geplanten Projektes aufzeigen.
Claudius Wurth, Agrarberater